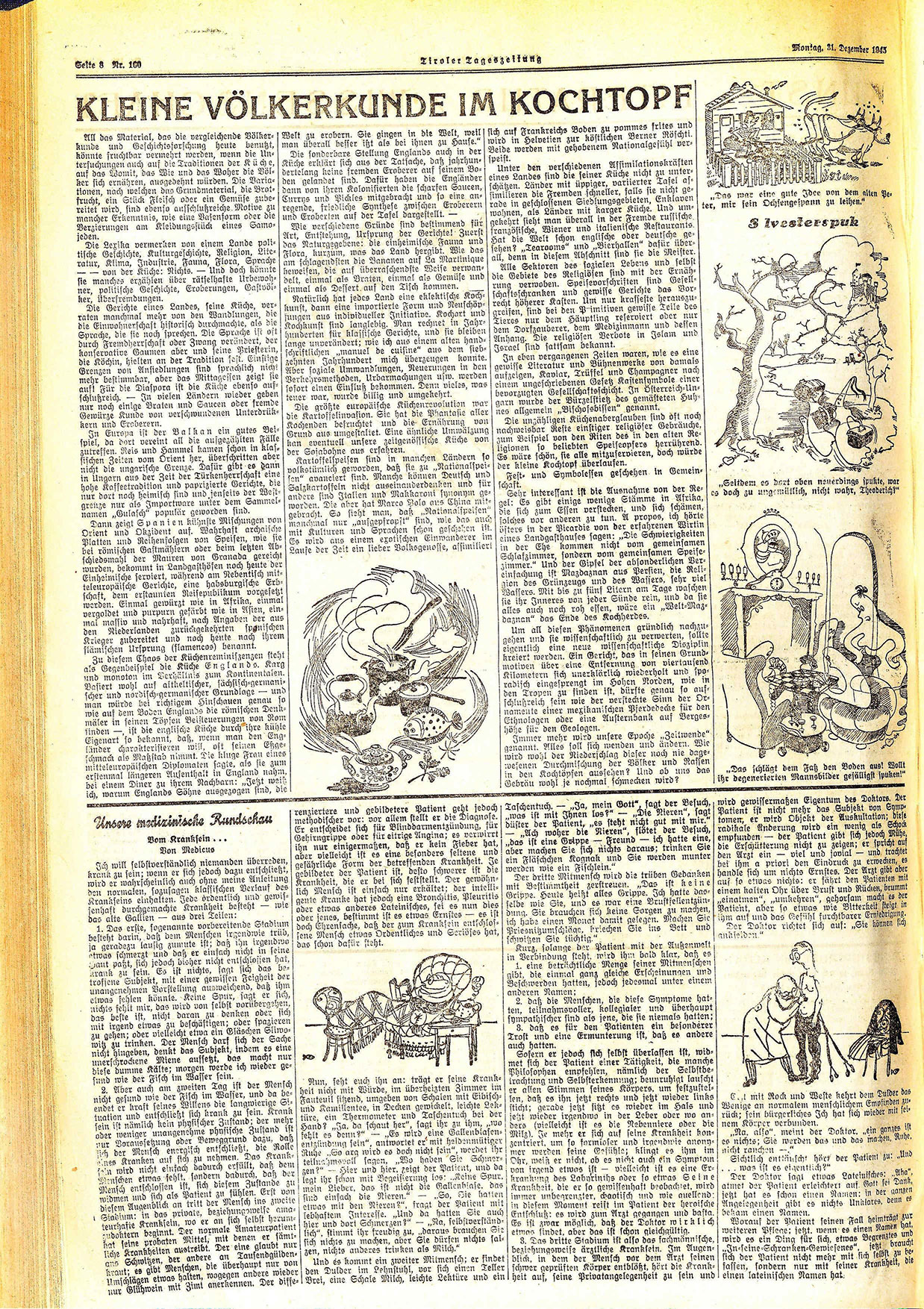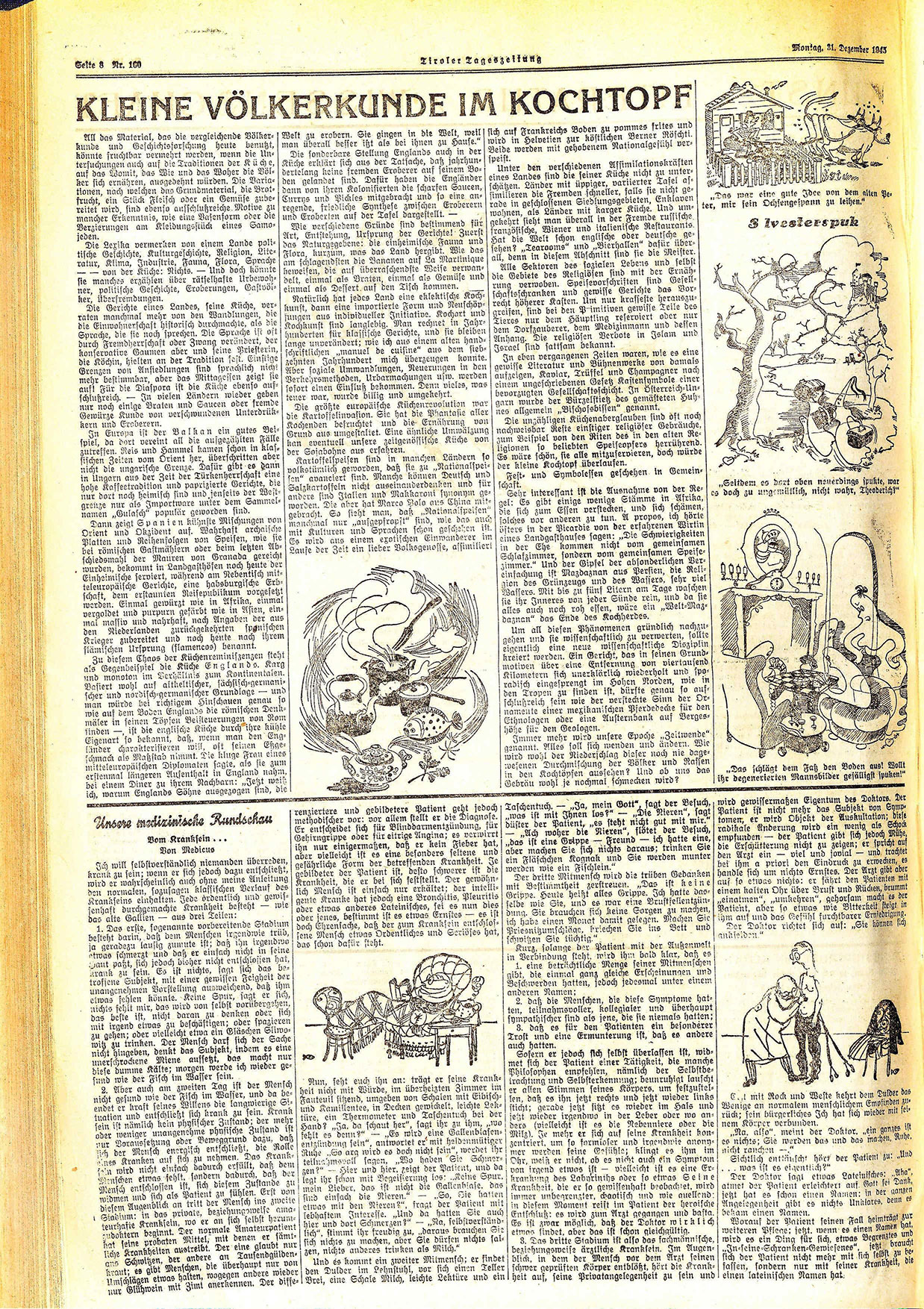Tiroler Tageszeitung 1945
Monat:12
- S.118
Suchen und Blättern in knapp 900 Ausgaben und 25.000 Seiten.
Gesamter Text dieser Seite:
Seite 8 Nr. 100
Tiroler Tageszeitung
Montag, 31. Dezember 1943
KELIZ VozRERkalDEIrI kSeHTeIT
All das Material, das die vergleichende Völkerkunde und Geschichtsforschung heute benutzt, könnte fruchtbar vermehrt werden, wenn die Untersuchungen auch auf die Traditionen der Küche, auf das Womit, das Wie und das Woher die Völker sich ernähren, ausgedehnt würden. Die Variationen, nach welchen das Grundmaterial, die Brotfrucht, ein Stück Fleisch oder ein Gemüse zubereitet wird, sind ebenso ausschlußreiche. Motive zu mancher Erkenntnis, wie eine Vasenform oder die Verzierungen am Kleidungsstück eines Samojeden.
Die Lexika vermerken von einem Lande politische Geschichte, Kulturgeschichte, Religion, Literatur, Klima, Industrie, Fauna, Flora, Sprache
—— von der Küche: Nichts. — Und doch könnte
sie manches erzählen über rätselhafte Urbewohner, politische Geschichte, Eroberungen, Gastvölker, überfremdungen.
Die Gerichte eines Landes, seine Küche, verraten manchmal mehr von den Wandlungen, die die Einwohnerschaft historisch durchmachte, als die Sprache, die sie noch sprechen. Die Sprache ist oft durch Fremdherrschaft oder Zwang verändert, der konservative Gaumen aber und seine Priesterin, die Köchin, hielten an der Tradition fest. Einstige Grenzen von Ansiedlungen sind sprachlich nicht mehr bestimmbar, aber das Mittagessen zeigt sie auf! Für die Diaspora ist die Küche ebenso aufschlußreich. — In vielen Ländern wieder geben nur noch einige Braten und Saucen oder fremde Gewürze Kunde von verschwundenen Unterdrükkern und Eroberern.
In Europa ist der Balkan ein gutes Beispiel, da dort vereint all die aufgezählten Fälle zutreffen. Reis und Hammel kamen schon in klassischen Zeiten vom Orient her überschritten aber nicht die ungarische Grenze. Dafür gibt es dann in Ungarn aus der Zeit der Türkenherrschaft eine hohe Kaffeetradition und paprizierte Gerichte, die nur dort noch heimisch sind und jenseits der Westgrenze nur als Importware unter dem Sammelnamen „Gulasch“ populär geworden sind.
Dann zeigt Spanien kühnste Mischungen von Orient und Okzident auf. Wahrhaft archaische Platten und Reihenfolgen von Speisen, wie sie bei römischen Gastmählern oder beim letzten Abschiedsmahl der Mauren von Granada gereicht wurden, bekommt in Landgasthöfen noch heute der Einheimische serviert, während am Nebentisch mitteleuropäische Gerichte, eine habsburgische Erbschaft, dem erstaunten Reisepublikum vorgesetzt werden. Einmal gewürzt wie in Afrika, einmal vergoldet und purpurn gefärbt wie in Asien, einmal massiv und nahrhaft, nach Angaben der aus den Niederlanden zurückgekehrten spgnischen Krieger zubereitet und noch heute nach ihrem flämischen Ursprung (flamencos) benannt.
Zu diesem Chaos der Küchenreminiszenzen steht als Gegenbeispiel die Küche Englands. Karg und monoton im Verhältnis zum Kontinentalen. Basiert wohl auf altheltischer, sächsisch=germanischer und nordisch=germanischer Grundlage — und man würde bei richtigem Hinschauen genau so wie auf dem Boden Englands die römischen Denkmäler in seinen Töpfen Beisteuerungen von Rom finden —, ist die englische Küche durchfihre kühle Eigenart so bekannt, daß, wenn man den Engländer charakterisieren will, oft seinen Eßgeschmack als Maßstab nimmt. Die kluge Frau eines mitteleuropäischen Diplomaten sagte, als sie zum erstenmal längeren Aufenthalt in England nahm, bei einem Diner zu ihrem Nachbarn: „Jetzt wein ich, warum Englands Söhne ausgezogen sind,
die
Welt zu erobern. Sie gingen in die Welt, weil man überall besser ißt als bei ihnen zu Hause.“
Die sonderbare Stellung Englands auch in der Küche erklärt sich aus der Tatsache, daß jahrhundertelang keine fremden Eroberer auf seinem Boden gelandet sind. Dafür haben die Engländer dann von ihren Kolonisierten die scharfen Saucen, Currys und Pickles mitgebracht und so eine anregende, friedliche Synthese zwischen Eroberern und Eroberten auf der Tafel dargestellt. —
Wie verschiedene Gründe sind bestimmend für Art, Entstehung, Ursprung der Gerichte! Zuerst das Naturgegebene: die einheimische Fauna und Flora, kurzum, was das Land hergibt. Wie das am schlagendsten die Bananen auf La Martinique beweisen, die auf überraschendste Weise verwandelt, einmal als Braten, einmal als Gemüse und einmal als Dessert auf den Tisch kommen.
Natürlich hat jedes Land eine eklektische Kochkunst, dann eine importierte Form und Neuschöpfungen aus individueller Initiative. Kochart und Kochkunst sind langlebig. Man rechnet in Jahrhunderten für klassische Gerichte, und sie bleiben lange unverändert; wie ich aus einem alten handschriftlichen „manuel de cuisine“ aus dem siebzehnten Jahrhundert mich überzeugen konnte. Aber soziale Umwandlungen, Neuerungen in den Verkehrsmethoden, Urbarmachungen usw. werden sofort einen Einfluß bekommen. Denn vieles, was teuer war, wurde billig und umgekehrt.
Die größte europäische Küchenrevolution war die Kartoffelinvasion. Sie hat die Phantasie aller Kochenden befruchtet und die Ernährung von Grund aus umgestaltet. Eine ähnliche Umwälzung kan eventuell unsere zeitgenössische Küche von der Sojabohne aus erfahren.
Kartoffelspeisen sind in manchen Ländern so volkstümlich geworden, daß sie zu „Nationalspeison“ avanciert sind. Manche können Deutsch und Salzkartoffeln nicht auseinanderdenken und für andere sind Italien und Makkaroni synonym geworden. Die aber hat Marco Polo aus China mitgebracht. So sieht man, daß „Nationalspeisen“ manchmal nur „aufgepfropft“ sind, wie das auch mit Kulturen und Sprachen schon geschehen ist. Es wird aus einem exotischen Einwanderer im Laufe der Zeit ein lieber Volksgenosse, assimilier!
sich auf Frankreichs Boden zu pommes frites und wird in Helvetien zur köstlichen Berner Röschti. Beide werden mit gehobenem Nationalgefühl verspeist. imklationeb:
Unter den verschiedenen Assimilationskräften eines Landes sind die seiner Küche nicht zu unterschätzen. Länder mit üppiger, variierter Tafel afsimilieren die Fremden schneller, falls sie nicht gerade in geschlossenen Siedlungsgebieten, Enklaven wohnen, als Länder mit karger Küche. Und umgekehrt sieht man überall in der Fremde russische französische, Wiener und italienische Restaurants. Hat die Welt schon englische oder deutsche gesehen? „Tearooms“ und „Bierhallen“ dafür überall, denn in diesem Abschnitt sind sie die Meister.
Alle Sektoren des sozialen Lebens und selbst die Gebiete des Religiösen sind mit der Ernährung verwoben. Speisevorschriften sind Gesellschaftsschranken und gewisse Gerichte das Vorrecht höherer Kasten. Um nur krasseste herauszugreifen, sind bei den Primitiven gewisse Teile des Tieres nur dem Häuptling reserviert oder nur dem Dorfzauberer, dem Medizinmann und dessen Anhang. Die religiösen Verbote in Islam und Israel sind sattsam bekannt.
In eben vergangenen Zeiten waren, wie es eine gewisse Literatur und Bühnenwerke von damals aufzeigen, Kaviar, Trüffel und Champagner nach einem ungeschriebenen Gesetz Kastensymbole einer bevorzugten Gesellschaftsschicht. In österreich=Ungarn wurde der Bürzelstietz des gemästeten Huhnes allgemein „Bischofsbissen“ genannt.
Die ungähligen Küchenaberglauben sind oft noch nachweisbar Reste einstiger religiöser Gebräuche, zum Beispiel von den Riten des in den alten Religionen so beliebten Speiseopfers herrührend. Es wäre schön, sie alle mitzuservieren, doch würde der kleine Kochtopf überlaufen.
Fest= und Symbolessen geschehen in Gemeinschaft.
Sehr interessant ist die Ausnahme von der Regel: Es gibt einige wenige Stämme in Afrika, die sich zum Essen verstecken, und sich schämen, solches vor anderen zu tun. A propos, ich hörte östers in der Picardie von der erfahrenen Wirtin eines Landgasthauses sagen: „Die Schwierigkeiten in der Ehe kommen nicht vom gemeinsamen Schlafzimmer, sondern vom gemeinsamen Speisezimmer.“ Und der Gipfel der absonderlichen Vereinfachung ist Mazdaznan aus Persien, die Religion des Grünzeugs und des Wassers, sehr viel Wassers. Mit bis zu fünf Litern am Tage waschen sie ihr Inneres von jeder Sünde rein, und da sie alles auch noch roh essen, wäre ein „Welt=Mazdaznan“ das Ende des Kochherdes.
Um all diesen Phänomenen gründlich nachzugehen und sie wissenschaftlich zu verwerten, sollte eigentlich eine neue wissenschaftliche Disziplin kreiert werden. Ein Gericht, das in seinen Grundmotiven über eine Entfernung von viertausend Kilometern sich unerklärlich wiederholt und sporadisch eingesprengt im Hohen Norden, wie in den Tropen zu finden ist, dürfte genau so aufschlußreich sein wie der versteckte Sinn der Ornamente einer mexikanischen Pferdedecke für den Ethnologen oder eine Austernbank auf Bergeshöhe für den Geologen.
Immer mehr wird unsere Epoche „Zeitwende“ genannt. Alles soll sich wenden und ändern. Wie wird wohl der Niederschlag dieser noch nie dagewesenen Durchmischung der Völker und Rassen in den Kochtöpfen aussehen? Und ob uns das Gebräu wohl je nochmal schmecken wird?
S loesterspuk
„Seitdem es dort oben neuerdings spukte, war es doch zu ungemütlich, nicht wahr, Theoderich?“
„Das schlägt dem Faß den Boden aus! Wollt ihr degenerierten Mannsbilder gefälligst spuken!“
Uindese modizinische Rundschau
Vom Kranksein ...
Von Medicus
Ich will selbstverständlich niemanden überreden, krank zu sein; wenn er sich jedoch dazu entschließt, wird er wahrscheinlich auch ohne meine Anleitung den normalen, sozusagen klassischen Verlauf des Krankseins einhalten. Jede ördentlich und gewissenhaft durchgemachte Krankheit besteht — wie das alte Gallien — aus drei Teilen:
1. Das erste, sogenannte vorbereitende Stadium besteht darin, daß dem Menschen irgendwie trüb, ja geradezu lausig zumute ist; daß ihn irgendwo atwas schmerzt und daß er einfach nicht in seine Haut paßt, sich jedoch bisher nicht entschlossen hat, grank zu sein. Es ist nichts, sagt sich das betrofsene Subjekt, mit einer gewissen Feigheit der unangenehmen Vorstellung ausweichend, daß ihm etwas fehlen könnte. Keine Spur, sagt er sich, nichts fehlt mir, das wird von selbst vorübergehen, das beste ist, nicht daran zu denken oder sich mit irgend etwas zu beschäftigen; oder spazieren zu gehen; oder vielleicht etwa ein Gläschen Sliwowitz zu trinken. Der Mensch darf sich der Sache nicht hingeben, denkt das Subjekt, indem es eine unerschrockene Miene aufsetzt, das
macht nur diese dumme Kälte; morgen werde ich wieder gesund wie der Fisch im Wasser sein.
2. Aber auch am zweiten Tag ist der Mensch nicht gesund wie der Fisch im Wasser, und da beendet er kraft seines Willens die langwierige Situation und entschließt sich krank zu sein. Krank sein ist nämlich kein physischer Zustand; der mehr oder weniger unangenehme physische Zustand ist nur Voraussetzung oder Beweggrund dazu, daß sich der Mensch energisch entschließt, die Rolle
Kranken auf sich zu nehmen. Das Kranksein wird nicht einfach dadurch erfüllt, daß dem Menschen etwas fehlt, sondern dadurch, daß der Mensch entschlossen ist, sich diesem Zustande zu widmen und sich als Patient zu fühlen. Erst von diesem Augenblick an tritt der Mensch ins zweite Stadium: in das private, beziehungsweise amateurhafte Kranksein, wo er an sich selbst herumendoktern beginnt. Der normale Amateurpatient hat seine probaten Mittel, mit denen er sämtliche Krankheiten austreibt. Der eine glaubt nur ans Schwitzen, der andere an Tausendgüldenkraut; es gibt Menschen, die überhaupt nur von Umschlägen etwas halten, wogegen andere wieder nur Glühwein mit Zimt anerkennen. Der diffe
renziertere und gebildetere Patient geht jedoch methodischer vor: vor allem stellt er die Diagnose. Er entscheidet sich für Blinddarmentzündung, für Gehirngrippe oder für eitrige Angina; es verwirrt ihn nur einigermaßen, daß er kein Fieber hat, aber vielleicht ist es eine besonders seltene und gefährliche Form der betreffenden Krankheit. Je gebildeter der Patient ist, desto schwerer ist die Krankheit, die er bei sich feststellt. Der gewöhnlich Mensch ist einfach nur erkältet; der intelligente Kranke hat jedoch eine Bronchitis, Pleuritis oder etwas anderes Lateinisches, sei es nun dies oder jenes, bestimmt ist es etwas Ernstes — es ist doch Ehrensache, daß der zum Kranksein entschlossene Mensch etwas Ordentliches und Seriöses hat, das schon dafür steht.
Nun, seht euch ihn an: trägt er seine Krankheit nicht mit Würde, im überheizten Zimmer im Fauteuil sitzend, umgeben von Schalen mit Eibischund Kamillentee, in Decken gewickelt, leichte Lektüre, ein Thermometer und Taschentuch bei der Hand? „Ja, da schaut her“, sagt ihr zu ihm, „wo fehlt es denn?“ — „Es wird eine Gallenblasenentzündung sein“, antwortet er mit heldenmütiger Ruhe „So arg wird es doch nicht sein“, werdet ihr teilnahmsvoll sagen, „Wo haben Sie Schmerzen?“ — Hier und hier, zeigt der Patient, und da legt ihr schon mit Begeisierung los: „Keine Spur, mein Lieber, das ist nicht die Gallenblase, das sind einfach die Nieren.“ — „So, Sie hatten etwas mit den Nieren?“, fragt der Patient mit lebhaftem Interesse. „Und da hatten Sie auch hier und dort
Schmerzen?“ — „Na, selbstverständlich“, stimmt ihr freudig zu, „daraus brauchen Sie sich nichts zu machen, aber Sie dürfen nichts salzen, nichts anderes trinken als Milch.“
Und es kommt ein zweiter Mitmensch; er findet den Dulder im Lehnstuhl, vor sich einen Teller Brei, eine Schale Milch, leichte Lektüre und ein
Taschentuch. — „Ja, mein Gott“ sagt der Besuch, „was ist mit Ihnen los?“ — „Die Nieren“, sagt düster der Patient, „es steht nicht gut mit mir.“ — „Ach woher die Nieren“, flötet der Besuch, „das ist eine Grippe — Freund — ich hatte eine, aber machen Sie sich nichts daraus; trinken Sie ein Fläschchen Kognak und Sie werden munter werden wie ein Fischlein.“
Der dritte Mitmensch wird die trüben Gedanken mit Bestimmtheit zerstreuen. „Das ist keine Grippe. Heute heißt alles Grippe. Ich hatte dasselbe wie Sie, und es war eine Brustfellentzündung. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, ich habe einen Monat damit gelegen. Machen Sie Priesnitzumschläge, briechen Sie ins Bett und schwitzen Sie tüchtig.“
Kurz, solange der Patient mit der Außenwelt in Verbindung steht, wird ihm bald klar, daß es
1. eine beträchtliche Menge seiner Mitmenschen aibt, die einmal ganz gleiche Erscheinungen und Beschwerden hatten, jedoch jedesmal unter einem anderen Namen;
2. daß die Menschen, die diese Symptome hatten, teilnahmsvoller, kollegialer und überhaupt sympathischer sind als jene, die sie niemals hatten;
3. daß es für den Patienten ein besonderer Trost und eine Ermunterung ist, daß es andere auch hatten.
Sofern er jedoch sich selbst überlassen ist, widmet sich der Patient einer Tätigkeit, die manche Philosophen empfehlen, nämlich der Selbstbetrachtung und Selbsterkennung; beunruhigt lauscht er allen Stimmen seines Körpers, um festzustellen, daß es ihn jetzt rechts und jetzt wieder links sticht; gerade jetzt sitzt es wieder im Hals und jetzt wieder irgendwo in der Leber oder wo anders (vielleicht ist es die Nebenniere oder die Milz). Je mehr er sich auf seine Krankheit konzentriert, um so formloser und irgendwie anonymer werden seine Gesühle; klingt es ihm im Ohr, weiß er nicht, ob es nicht auch ein Symptom von irgend etwas ist — vielleicht ist es eine Erkrankung des Labyrinths oder so etwas Seine Krankheit, die er so gewissenhaft beobachtet, wird immer unbegrenzter,
chaotisch und wie quellend: in diesem Moment reist im Patient der heroische Entschluß: es wird zum Arzt gegangen und basta. Es ist zwar möglich, daß der Doktor wirklich etmas findet, aber das ist schon gleichgültig.
3. Das dritte Stadium ist also das fachmännische, beziehungsweise ärztliche Kranksein. Im Augenblick, in dem der Mensch vor dem Arzt seinen schwer geprüften Körper entblößt, hört die Krankheit auf, seine Privatangelegenheit zu sein und
wird gewissermaßen Eigentum des Doktors. Der Patient ist nicht mehr das Subjekt von Symptomen, er wird Objekt der Auskultation; diese radikale Anderung wird ein wenig als Schock empfunden — der Patient gibt sich jedoch Mühe. die Erschütterung nicht zu zeigen; er spricht auf den Arzt ein — viel und jovial — und trachtet bei ihm a priori den Eindruck zu erwecken, es handle sich um nichts Ernstes. Der Arzt gibt aber auf so etwas nichts: er fährt den Patienten mit einem kalten Ohr über Brust und Rücken, brummt „einatmen“, „umkehren“, gehorsam macht es der Patient, aber so etwas wie Bitterkeit steigt in ihm auf und das Gefühl furchtbarer Erniedrigung.
Der Doktor richtet sich auf: „Sie hönnen sich ankseiden“
C.,1 mit Rock und Weste kehrt dem Dulder das Wenige an normalem menschlichem Empfinden zurück; sein bürgerliches Ich hat sich wieder mit seinem Körper verbunden.
„Na. also“ meint der Doktor, „ein ganzes ist es nichts; Sie werden das und das machen, Ruhe, nicht rauchen —
Sichtlich enttäuscht hört der Patient zu: „Und .. was ist es eigentlich?“
Der Doktor sagt etivas Lateinisches: „Aha“, atmet der Patient erleichtert auf. Gott sei Dank, jetzt hat es schon einen Namen; in der ganzen Angelegenheit gibt es nichts Unklares, denn es bekam einen Namen.
Worauf der Patient seinen Fall heimträgt zur weiteren Pflege; jetzt, wenn es einen Namen hat, wird es ein Ding für sich, etwas Begrenztes und In=seine=Schranken=Gewiesenes“, jetzt braucht sich der Patient nicht mehr mit sich selbst zu befassen, sondern nur mit seiner Krankheit, die einen lateinischen Namen hat.